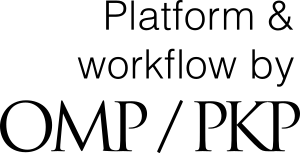Ancient population genetics of the 6000–4000 cal BC period of the Carpathian Basin
https://doi.org/10.34780/466n-4d6e
Liste der Beiträger/innen
- Anna Szécsényi-Nagy [Kapitelautor/in] https://orcid.org/0000-0003-2095-738X
- Victoria Keerl [Kapitelautor/in]
- János Jakucs [Kapitelautor/in] https://orcid.org/0000-0002-2132-5950
- Kitti Köhler [Kapitelautor/in]
- Krisztián Oross [Kapitelautor/in] https://orcid.org/0000-0002-5311-3995
- Anett Osztás [Kapitelautor/in] https://orcid.org/0000-0002-8470-0770
- Tibor Marton [Kapitelautor/in] https://orcid.org/0000-0002-3770-2001
- Balázs Gusztáv Mende [Kapitelautor/in] https://orcid.org/0000-0001-7667-8633
- Kurt W. Alt [Kapitelautor/in] https://orcid.org/0000-0001-6938-643X
- Eszter Bánffy [Sammelbandherausgeber/in] https://orcid.org/0000-0001-5156-826X
Über dieses Buch
Die vorliegende Studie war Teil des interdisziplinären Forschungsprojektes mit dem Titel “Bevölkerungsgeschichte des Karpatenbeckens in der Jungsteinzeit und ihr Einfluss auf die Besiedlung Mitteleuropas”, das zwischen 2010 und 2014 von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wurde. Den Fokus dieser Studie bildet die populationsgenetische Analyse der Struktur und Dynamik der neolithischen Bevölkerungsbewegungen im 6.–5. Jahrtausend v. Chr. im Karpatenbecken, insbesondere im heutigen Ungarn. Im Vergleich zur authochtonen Jäger-und-Sammler-Bevölkerung brachten die ersten neolithischen Einwanderer aus Starčevo- und Körös-Populationen viele neue mtDNA-Linien in die Region, die in den nachfolgenden Zeitperioden weiter existierten. Die lokalen Starčevo- und linearbandkeramischen Populationen im westlichen Karpatenbecken (LBKT) und die etwas jüngeren linearbandkeramischen Populationen in Mitteleuropa (LBK) besitzen so starke Ähnlichkeit auf mitochondrialer und Y-chromosomaler Ebene, dass die Verbreitung der LBK nach Mitteleuropa sehr schlüssig durch Wanderungsereignisse zu erklären ist. Die ursprüngliche Herkunft der LBK-Gruppen in Mitteleuropa aus dem Karpatenbecken wird auch durch archäologische Untersuchungsergebnisse gestützt. Während des Neolithisierungsprozesses war Transdanubien ein wichtiger Teil der kontinentalen Wanderroute, der eine Art Korridor auf dem Weg der frühen Bauern nach Mitteleuropa dargestellt haben könnte.
Die hohe maternal-genetische Variabilität in den frühneolithischen Populationen verändert sich in den zeitlich darauf nachfolgenden Populationen des Karpatenbeckens kaum. Daher scheinen nur kleinere Infiltrationen und Immigrationsereignisse während des Mittel- und Spätneolithikums stattgefunden zu haben.
Diese Studie basiert auf einem exzeptionell großen mtDNA-Datensatz des 6.–5. Jahrtausends v. Chr. aus dem Karpatenbecken. Die transdiziplinären Forschungsmethoden beziehen biologische, kulturelle und demographische Belege in die Untersuchung ein und ermöglichen so eine integrative Auswertung und Diskussion der Ergebnisse. Abgeschlossen wird die Studie durch eine Auswertung der aktuellen archäogenomischen Ergebnisse. Diese unterstützen im Wesentlichen die Annahmen von mitochondrialen DNA-Analysen, verfeinern aber auch einige frühere Schlussfolgerungen.